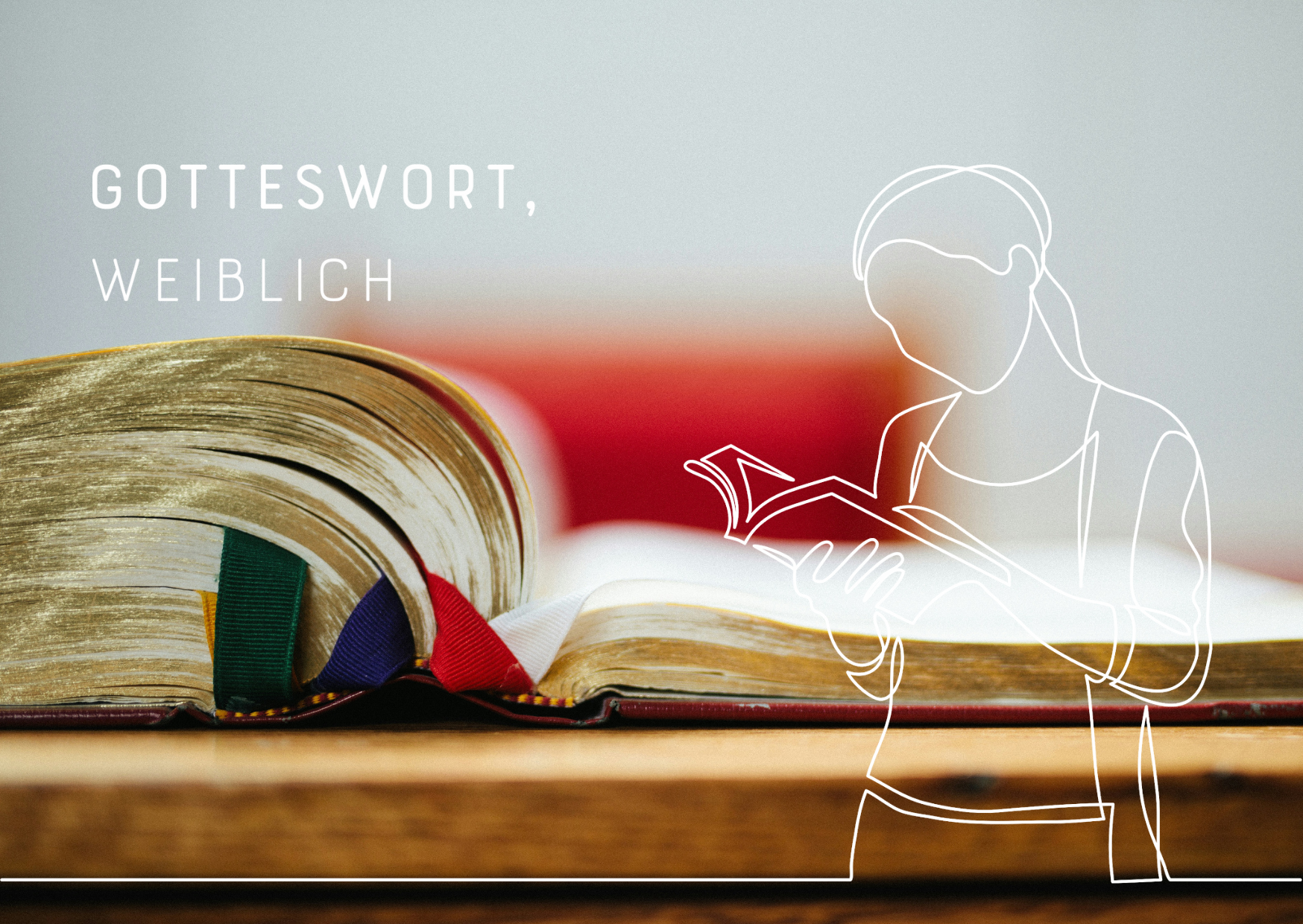
19. Sonntag im Jahreskreis C // zum Eingangsgebet
Ich formuliere nicht oft Eingangsgebete. Ehrlich gesagt, finde ich die Entwicklung einer allgemeinen Vorlage für diesen Zweck sehr anspruchsvoll; mir gehen Eingangsgebete viel leichter von der Hand, wenn ich sie für einen bestimmten Kontext schreibe. Was soll man ganz allgemein auch sagen außer "Hier sind wir, bitte sei auch da, amen"? Das kann man natürlich schöner formulieren: "Wir hoffen, dass du spürbar wirst für uns, wir sehnen uns danach, dass unser Herz für einen Moment in deinem Rhythmus schlägt, dass du die Abstände zwischen uns mit deiner Gegenwart füllst..." Die Gebetsworte können ja nur Einladung ins Gebet sein, sie sind nicht das Gebet selbst - zum Gebet werden sie, wenn Menschen sie mitvollziehen und ihr Leben mit ihnen verknüpfen, bzw. wenn Menschen an sie anknüpfen, um die Seiten ihres Lebens vor Gott aufzublättern.
Schon allein deswegen, weil ich sie für eine anspruchsvolle Gattung halte, liegt es mir fern, den Tagesgebeten des Messbuchs mit Geringschätzung zu begegnen. Aber manchmal bin ich wirklich ratlos angesichts des theologischen Wunschdenkens wie zum Beispiel am 8. Sonntag im Jahreskreis C, wo das Tagesgebet lautet: "Allmächtiger Gott, deine Vorsehung bestimmt den Lauf der Dinge und das Schicksal der Menschen. Lenke die Welt in den Bahnen deiner Ordnung, damit die Kirche in Frieden deinen Auftrag erfüllen kann." Als hätten wir nicht viel ernsthaftes Ringen um die Begriffe der Allmacht und der Vorsehung hinter uns, die spätestens an den Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts zerbrochen sind...
Dieses Wunschdenken, das die liturgischen Texte gegen gegenwärtige Theologie imprägniert, ist das eine. Das andere ist der formelle Ton und die dogmatische Belehrung, die Gott doch wohl nicht nötig hat, wie beim Tagesgebet für den 19. Sonntag im Jahreskreis C:
"Allmächtiger Gott,
wir dürfen dich Vater nennen,
denn du hast uns an Kindes statt angenommen
und uns den Geist deines Sohnes gesandt.
Gib, dass wir in diesem Geist wachsen
und einst das verheißene Erbe empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus."
Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt und nicht schon bei der Einladung "Lasset uns beten" auf intellektuelle Notwehr schaltet und innerlich sanft wegdriftet, dann verwendet man tatsächlich im inneren Nachvollzug eine Sprachform gegenüber Gott, die vergleichbar ist mit einer Ansprache wie der folgenden: "Hoch verehrte Frau Dekanin Winkelhecke, wir dürfen dich Gisela nennen, denn du hast dich als große Freundin unseres quantentechnologischen Instituts erwiesen...". Damit ist der Rahmen gesetzt: Wir befinden uns auf einem förmlichen Empfang (nachher gibt es Sekt und Lachshäppchen), und Professorin Dr. Dr. h.c.mult. Gisela Winkelhecke ist natürlich nicht wirklich unsere Freundin. Sie ist eine Respektsperson, von der Institutsleitung gefürchtet und für die Studierenden eine ferne Gestalt, von der die finanzielle Ausstattung der Hilfskraft-Stellen abhängt, bei der sie aber niemals anklopfen würden, wenn sie in ihrem Physikstudium ein Problem haben.
Wie absurd ist es, Gott gegenüber zwar zu sagen, "wir dürfen dich Vater nennen", das dann aber nicht zu tun? Die Sprachform dieses Gebets lädt nicht annähernd in das vertrauensvolle Gottesverhältnis ein, das sie theoretisch behauptet. In zwischenmenschlicher Kommunikation ist eine Anrede, die sich inhaltlich nicht die adressierte Partei, sondern an das umstehende Publikum wendet, nicht selten eine Form der passiven Aggression, in jedem Fall spielt sie über Bande und vermeidet den direkten Kontakt.
In irritierendem Kontrast zu dieser förmlichen Anrede, die die behauptete Nähe nicht wagt und zudem noch das sprachliche Monster "an Kindes statt annehmen" verwendet, steht der folgende einfache Imperativ: "Gib." Da gibt es keinen Spielraum mehr für Gott, kein "mögest du wahr werden lassen", kein "wir bitten dich um", kein "wir hoffen" - nur "gib". Der Verdacht drängt sich auf, dass dieser Imperativ nur in Frage kommt, weil hier mit dem Priester eine Figur imaginiert wird, die eine Mittlerfunktion zwischen Gott und Menschen einnimmt und dabei näher an Gott als an den Menschen angesiedelt ist. Nur sie kann diese Gewissheit vermitteln und diesen Imperativ wagen.
Nun könnte man einwenden, dass der umstandslose Imperativ doch ein Beleg für das oben ausgedrückte Vertrauensverhältnis wäre. Allerdings ist er inhaltlich an das Bemühen des Menschen gekoppelt: Wir müssen uns ordentlich Mühe geben, obwohl willentlich zu wachsen eine Aufgabe ist, an der nicht nur in ihrer Alterskohorte vergleichsweise klein geratene Grundschulkinder regelmäßig scheitern. Das Gebet fordert also etwas von Gott, auch noch relativ rüde, was dann aber in der Erfüllung am Menschen hängt. Das ist ein kluger Schachzug nach der einleitenden Anrede "Allmächtiger Gott" - wenn es nicht eintrifft, ist Gott damit entlastet. Ganz abgesehen davon ist "gib, dass wir wachsen" eine seltsame sprachliche Form, die sich auch mit gärtnerischem Fachwissen nicht erschließen mag. Wer bis hierhin mitgekommen ist, kann sich dann noch fragen, was das verheißene Erbe wohl sein mag und welches Nachlassgericht dafür zuständig sein könnte.
Ich zweifle an, dass dieses Gebet in Menschen, die es im Gottesdienst hören, Resonanz entfalten kann. Sie müssten dafür die inneren Spannungen zwischen der förmlichen Anrede und der behaupteten, aber nicht gewagten Nähe überwinden, ihren Status als "als Kindes statt Angenommene" bejahen und dann noch den Willensakt absolvieren, ein Wachstum im Geist Jesu anzustreben, wobei sie eine Vorstellung davon brauchen, was oder wer das sein könnte.
Ich halte den Wert eines Gebets, das intellektuelle Anstrengung verlangt, um es sprachlich zu erfassen, das in sich nicht konsistent gestaltet ist und das hochkomplexe, aber nicht unbedingt gegenwartstaugliche theologische Figuren enthält, für durchaus überschaubar. Und ich fände es wesentlich schöner, wenn die Vorbeterin oder der Vorbeter die Gottesdienstgemeinschaft einladen würde, zur Ruhe zu kommen, sich einzubergen in Gottes Gegenwärtigkeit und loszulassen, was sie sonst in Atem hält, für eine geschenkte Stunde, in der die Seelen der Einzelnen satt werden mögen.
Vielleicht so:
Gott, wer du auch bist und wie du auch heißt,
hier sind wir.
Mit Schuldgefühlen, mit Ängsten, mit Dankbarkeit und mit Hoffnung.
Für diese gesegnete Stunde sind wir deine Gemeinde, verbunden durch dich,
und auch wenn wir nicht in Worte fassen können, was uns an Gefühlen durchströmt,
so spüren wir doch: Es hat mit dir zu tun, mit deiner Fülle und deinem Segen.
Du Gott-für-uns, sei uns gelobt.
Oder vielleicht ganz anders. Berührend zu beten, ohne Worthülsen zu produzieren und ohne Leuten in die Seele zu latschen, wäre ein gutes Ziel.
//
Zur Lesung aus dem Hebräerbrief: Beitrag von 2022